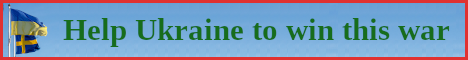
Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - 4. Recht und Mythos

<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
AXEL HÄGERSTRÖM IO7
mes’schen Theorie am nächsten, die die Gefühle nicht nur aus bestimm-
ten körperlichen Zuständen hervorgehen lässt, sondern sie als eben
diese Zustände selbst erklärt. »Our natural way of thinking» — so
erklärt James — »is that the mental perception of some facts excites
the mental affection called the emotion, and that this latter state of
mind gives rise to the bodily expression. My theory, on the contrary,
is that the bodily changes follow directly the perception of the exciting fact,
and that our feeling of the same changes as they occur i s the emotion. »1)
Im gleichen Sinne betont Hägerström, dass man, wenn man bestimmen
wolle, was Zorn, Entsetzen, Freude oder Kummer sei, letzten Endes
nichts anderes finden könne, als bei dem Organismus vorhandene ei-
genartige Qualitäten. »Kummer ist ein unangenehmer lastender Druck
auf dem Organismus in Verbindung mit Bewegungen, welche auf die
Aufhebung dessen gerichtet sind, dessen Vorstellung mit diesen Quali-
täten assoziiert ist. Entsetzen ist die mit stärkster Unlust verknüpfte
Bewegungslähmung, die wir bei gewissen Wahrnehmungen erfahren
u. s. w. Nur auf diese Weise können die Gefühlsqualitäten selbst in
ihrer Realität fixiert werden.»2) Aber eben wenn man diese Häger-
ström’sche Definition annimmt, wird es höchst problematisch, ob
man zu einer wirklichen Analyse des Pflicht&egn//s gelangt, indem
man ihn einfach in bestimmte Gefühle und in die Assoziationen,
die sich an sie anknüpfen, auflöst. Auch wenn wir nicht nur auf
alle metaphysischen Erklärungen des Willens verzichten, sondern es
auch ablehnen, in ihm, gemäss der Vermögenspsychologie des i8:ten
Jahrhunderts, ein eigenes »Seelenvermögen» zu sehen, bleibt doch ein
Moment erhalten, das das Phaenomen des »Wollens» als solches
kennzeichnet und uns nötigt, in ihm eine Erscheinung sui generis
zu sehen. Empfindung und Gefühl sind wesentlich konstatierend;
sie beschreiben einen bestimmten Zustand, in dem sich der Orga-
nismus momentan befindet. Aber lässt sich hieraus der Inhalt
des Rechtsbegriffs und des Pflichtbegriffs gewinnen? Unterschei-
det sich die Bindung die in ihnen gedacht wird, in nichts
von Zuständen der Angst, der Gehemmtheit, des lastenden Druc-
kes? Mir scheint, dass eine Betrachtung des schlichten phaenome-
nologischen »Befundes » des Pflichtbewusstseins ausreicht, um hier
die Grenze sicher zu ziehen. Denn in der Pflicht liegt keineswegs
1) James, Principles of Psychology, II, London 1901, 449.
2) Festschr. für A. Grotenfelt 1933, S. 65.
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>