
Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...
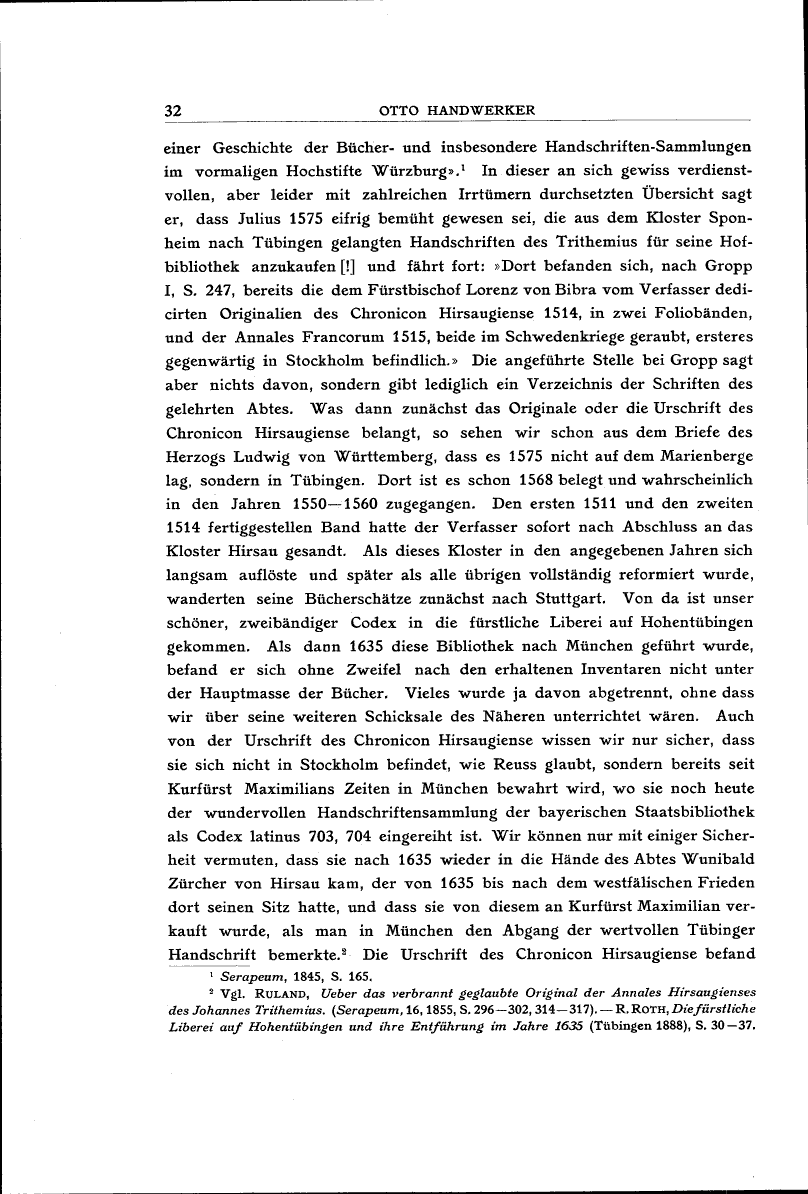
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
32 OTTO HANDWERKER
einer Geschichte der Bucher- und insbesondere Handschriften-Sammlungen
im vormaligen Hochstifte Wurzburg».1 In dieser an sich gewiss
verdienstvollen, aber leider mit zahlreichen Irrtümern durchsetzten Übersicht sagt
er, dass Julius 1575 eifrig bemüht gewesen sei, die aus dem Kloster
Sponheim nach Tübingen gelangten Handschriften des Trithemius für seine
Hofbibliothek anzukaufen [!] und fährt fort: »Dort befanden sich, nach Gropp
I, S. 247, bereits die dem Fürstbischof Lorenz von Bibra vom Verfasser
dedi-cirten Originalien des Chronicon Hirsaugiense 1514, in zwei Foliobänden,
und der Annales Francorum 1515, beide im Schwedenkriege geraubt, ersteres
gegenwärtig in Stockholm befindlich.» Die angeführte Stelle bei Gropp sagt
aber nichts davon, sondern gibt lediglich ein Verzeichnis der Schriften des
gelehrten Abtes. Was dann zunächst das Originale oder die Urschrift des
Chronicon Hirsaugiense belangt, so sehen wir schon aus dem Briefe des
Herzogs Ludwig von Württemberg, dass es 1575 nicht auf dem Marienberge
lag, sondern in Tübingen. Dort ist es schon 1568 belegt und wahrscheinlich
in den Jahren 1550—1560 zugegangen. Den ersten 1511 und den zweiten
1514 fertiggestellen Band hatte der Verfasser sofort nach Abschluss an das
Kloster Hirsau gesandt. Als dieses Kloster in den angegebenen Jahren sich
langsam auflöste und später als alle übrigen vollständig reformiert wurde,
wanderten seine Bücherschätze zunächst nach Stuttgart. Von da ist unser
schöner, zweibändiger Codex in die fürstliche Liberei auf Hohentübingen
gekommen. Als dann 1635 diese Bibliothek nach München geführt wurde,
befand er sich ohne Zweifel nach den erhaltenen Inventaren nicht unter
der Hauptmasse der Bücher. Vieles wurde ja davon abgetrennt, ohne dass
wir über seine weiteren Schicksale des Näheren unterrichtet wären. Auch
von der Urschrift des Chronicon Hirsaugiense wissen wir nur sicher, dass
sie sich nicht in Stockholm befindet, wie Reuss glaubt, sondern bereits seit
Kurfürst Maximilians Zeiten in München bewahrt wird, wo sie noch heute
der wundervollen Handschriftensammlung der bayerischen Staatsbibliothek
als Codex latinus 703, 704 eingereiht ist. Wir können nur mit einiger
Sicherheit vermuten, dass sie nach 1635 wieder in die Hände des Abtes Wunibald
Zürcher von Hirsau kam, der von 1635 bis nach dem westfälischen Frieden
dort seinen Sitz hatte, und dass sie von diesem an Kurfürst Maximilian
verkauft wurde, als man in München den Abgang der wertvollen Tübinger
Handschrift bemerkte.2 Die Urschrift des Chronicon Hirsaugiense befand
1 Serapeum, 1845, S. 165.
2 Vgl. Ruland, lieber das verbrannt geglaubte Original der Annales Hirsaugienses
des Johannes Trithemius. (Serapeum, 16,1855, S. 296—302, 314—317). — R. Roth, Die fürstliche
Liberei auf Hohentübingen und ihre Entführung im Jahre 1635 (Tübingen 1888), S. 30—37.
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>