
Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
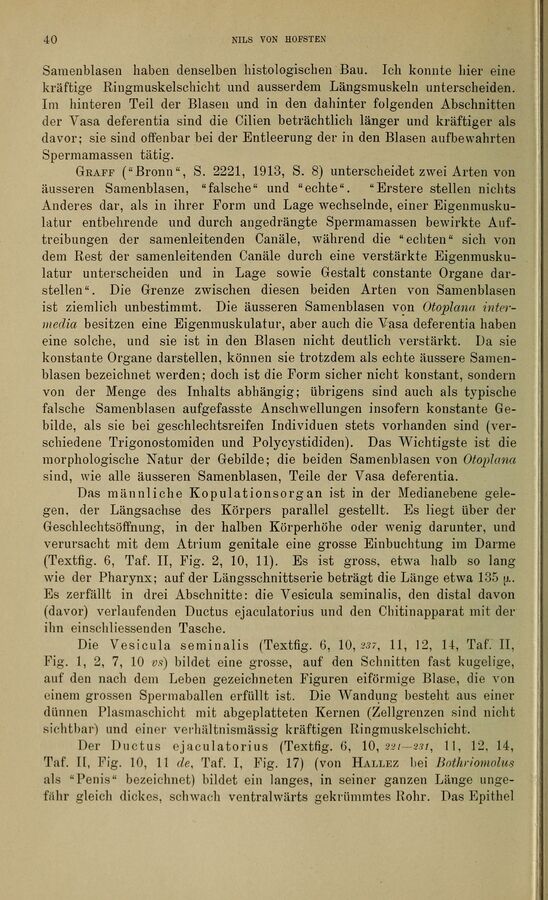
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Samenblasen haben denselben histologischen Bau. Ich konnte hier eine
kräftige Ringmuskelschicht und ausserdem Längsmuskeln unterscheiden.
Im hinteren Teil der Blasen und in den dahinter folgenden Abschnitten
der Vasa deferentia sind die Cilien beträchtlich länger und kräftiger als
davor; sie sind offenbar bei der Entleerung der in den Blasen aufbewahrten
Spermamassen tätig.
Gkaff (“Bronn“, S. 2221, 1913, S. 8) unterscheidet zwei Arten von
äusseren Samenblasen, “falsche“ und “echte“. “Erstere stellen nichts
Anderes dar, als in ihrer Form und Lage wechselnde, einer
Eigenmuskulatur entbehrende und durch angedrängte Spermamassen bewirkte
Auftreibungen der samenleitenden Canäle, während die “echten“ sich von
dem Rest der samenleitenden Canäle durch eine verstärkte
Eigenmuskulatur unterscheiden und in Lage sowie Gestalt constante Organe
darstellen“. Die Grenze zwischen diesen beiden Arten von Samenblasen
ist ziemlich unbestimmt. Die äusseren Samenblasen von Otoplana
intermedia besitzen eine Eigenmuskulatur, aber auch die Vasa deferentia haben
eine solche, und sie ist in den Blasen nicht deutlich verstärkt. Da sie
konstante Organe darstellen, können sie trotzdem als echte äussere
Samenblasen bezeichnet werden; doch ist die Form sicher nicht konstant, sondern
von der Menge des Inhalts abhängig; übrigens sind auch als typische
falsche Samenblasen aufgefasste Anschwellungen insofern konstante
Gebilde, als sie bei geschlechtsreifen Individuen stets vorhanden sind
(verschiedene Trigonostomiden und Polycystididen). Das Wichtigste ist die
morphologische Natur der Gebilde; die beiden Samenblasen von Otoplana
sind, wie alle äusseren Samenblasen, Teile der Vasa deferentia.
Das männliche Kopulationsorgan ist in der Medianebene
gelegen, der Längsachse des Körpers parallel gestellt. Es liegt über der
Geschlechtsöffnung, in der halben Körperhöhe oder wenig darunter, und
verursacht mit dem Atrium genitale eine grosse Einbuchtung im Darme
(Textfig. 6, Taf. II, Fig. 2, 10, 11). Es ist gross, etwa halb so lang
wie der Pharynx; auf der Längsschnittserie beträgt die Länge etwa 135 p.
Es zerfällt in drei Abschnitte: die Vesicula seminalis, den distal davon
(davor) verlaufenden Ductus ejaculatorius und den Chitinapparat mit der
ihn einschliessenden Tasche.
Die Vesicula seminalis (Textfig. 6, 10, 237, 11, 12, 14, Taf. II,
Fig. 1, 2, 7, 10 vs) bildet eine grosse, auf den Schnitten fast kugelige,
auf den nach dem Leben gezeichneten Figuren eiförmige Blase, die von
einem grossen Spermaballen erfüllt ist. Die Wandung besteht aus einer
dünnen Plasmaschicht mit abgeplatteten Kernen (Zellgrenzen sind nicht
sichtbar) und einer verhältnismässig kräftigen Ringmuskelschicht.
Der Ductus ejaculatorius (Textfig. 6, 10, 221—2«, 11, 12, 14,
Taf. II, Fig. 10, 11 de, Taf. I, Fig. 17) (von Hallez hei Bothriomolus
als “Penis“ bezeichnet) bildet ein langes, in seiner ganzen Länge
ungefähr gleich dickes, schwach ventralwärts gekrümmtes Rohr. Das Epithel
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>