
Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
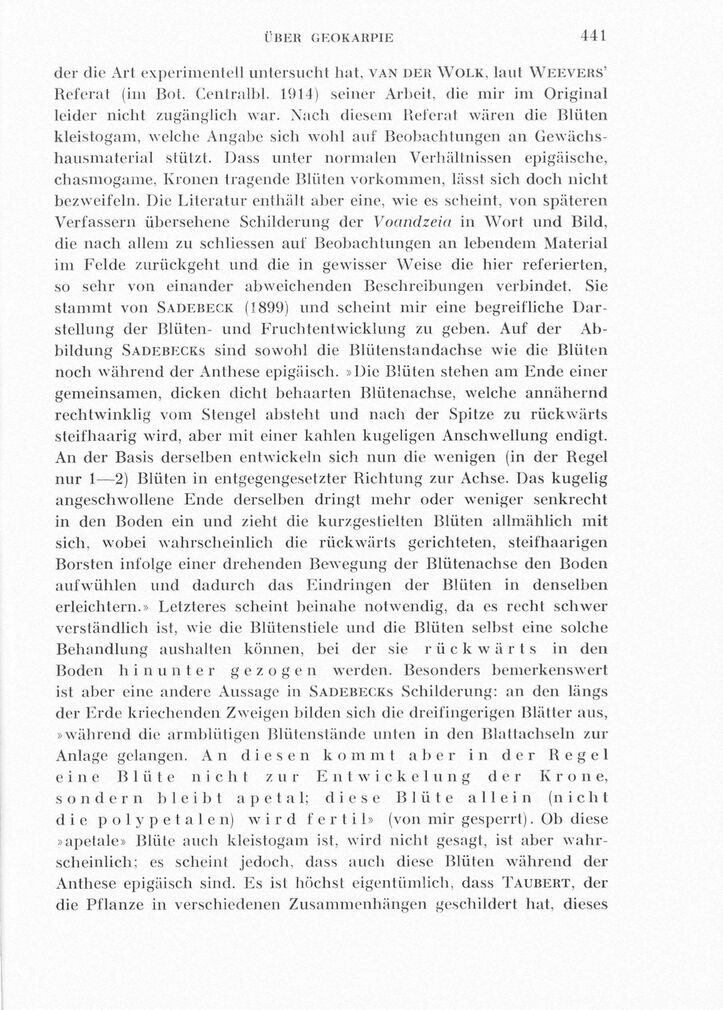
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
ÜBER GEOKARI’IE
441
der die Art experimentell untersucht hat, van der Wölk, laut Weevers’
Referat (im Bot. Cenlralbl. 1914) seiner Arbeit, die mir im Original
leider nicht zugänglich war. Nach diesem Referat wären die Blüten
kleistogam, welche Angabe sich wohl auf Beobachtungen an
Gewächshausmaterial stützt. Dass unter normalen Verhältnissen epigäische,
chasmogame. Kronen tragende Blüten vorkommen, lässt sich doch nicht
bezweifeln. Die Literatur enthält aber eine, wie es scheint, von späteren
Verfassern übersehene Schilderung der Voandzeia in Wort und Bild,
die nach allem zu schliessen auf Beobachtungen an lebendem Material
im Felde zurückgeht und die in gewisser Weise die hier referierten,
so sehr von einander abweichenden Beschreibungen verbindet. Sie
stammt von Sadebec.k (1899) und scheint mir eine begreifliche
Darstellung der Blüten- und Fruchtentwicklung zu geben. Auf der
Abbildung Sadebecks sind sowohl die Blütenstandachse wie die Blüten
noch während der Anthese epigäisch. »Die Blüten stehen am Ende einer
gemeinsamen, dicken dicht behaarten Blütenachse, welche annähernd
rechtwinklig vom Stengel absteht und nach der Spitze zu rückwärts
steifhaarig wird, aber mit einer kahlen kugeligen Anschwellung endigt.
An der Basis derselben entwickeln sich nun die wenigen (in der Regel
nur 1—2) Blüten in entgegengesetzter Richtung zur Achse. Das kugelig
angeschwollene Ende derselben dringt mehr oder weniger senkrecht
in den Boden ein und zieht die kurzgestielten Blüten allmählich mit
sich, wobei wahrscheinlich die rückwärts gerichteten, steifhaarigen
Borsten infolge einer drehenden Bewegung der Blütenachse den Boden
aufwühlen und dadurch das Eindringen der Blüten in denselben
erleichtern.» Letzteres scheint beinahe notwendig, da es recht schwer
verständlich ist, wie die Blütenstiele und die Blüten selbst eine solche
Behandlung aushalten können, bei der sie r ü c k w ärts in den
Boden hinunter gezogen werden. Besonders bemerkenswert
ist aber eine andere Aussage in Sadebecks Schilderung: an den längs
der Erde kriechenden Zweigen bilden sich die dreil’ingerigen Blätter aus,
»während die armbliitigen Blütenstände unten in den Blattachseln zur
Anlage gelangen. An diesen k o m m t aber i n der Regel
eine Blüte nicht zur Entwickelung der Kron e,
sondern bleibt a p e t a 1; diese Blüte allein (nicht
die polypetalen) wird fertil» (von mir gesperrt). Ob diese
»apetale» Blüte auch kleistogam ist, wird nicht gesagt, ist aber
wahrscheinlich; es scheint jedoch, dass auch diese Blüten während der
Anthese epigäisch sind. Es isl höchst eigentümlich, dass Taubert, der
die Pflanze in verschiedenen Zusammenhängen geschildert hat, dieses
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>